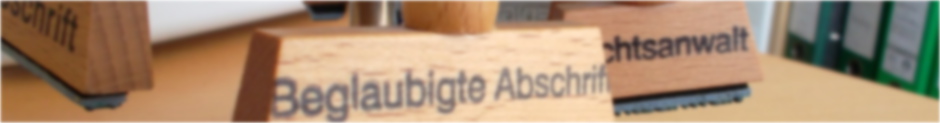Aktuelles
Ich informiere Sie an dieser Stelle regelmäßig über Neuigkeiten aus meiner Kanzlei sowie über interessante Urteile und Gesetzesänderungen. Schauen Sie doch öfter mal vorbei.
Mai 2024: Urteil des Monats
Einem Arbeitnehmer ist bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung zu erteilen, und zwar in Textform. Dies ergibt sich aus § 108 GewO. Die in Textform erstellte Abrechnung darf von einem Arbeitgeber auch digital erstellt und in ein für den Arbeitnehmer eingerichtetes digitales Mitarbeiterpostfach eingelegt werden. Jedoch bedarf es für diese Gestaltung der ausdrücklichen Einverständnisses des Arbeitnehmers. Liegt diese nicht vor, geht die in das digitale Postfach eingelegte Abrechnung dem Arbeitnehmer im Zweifel nicht zu (LArbG Niedersachsen, 16.1.2024, ZAP 10/2024 v. 10.5.2024).
Hinweis: Über eine Betriebsvereinbarung kann die fehlende Einwilligung des Mitarbeiters nicht ersetzt werden!
April 2024: Urteil des Monats
Wird von einem Arbeitgeber ohne Grund bzw. unwirksam Kurzarbeit angeordnet, müssen die betroffenen Arbeitnehmer bei ihrem Arbeitgeber gegen die Anordnung der Kurzarbeit protestieren und ihre Arbeitskraft zumindest wörtlich anzubieten. Sonst gehen sie bei der Vergütung leer aus (LArbG Baden-Württemberg, 17.10.2023, 15 Sa 5/23, ZAP 9/2024 v. 29.4.2024).
Hinweis: Die bloße Nachfrage, wann es mit der Arbeit weitergehe oder warum andere Kollegen nicht von Kurzarbeit betroffen seien, stellt keinen relevanten Protest dar.
März 2024: Urteil des Monats
Ein Privatmann, der sich außergerichtlich einer unberechtigten Inanspruchnahme einer Forderung erwehrt, hat in der Regel keinen Anspruch auf Erstattung seiner Kosten. Es fehlt hier an einer gesetzlichen Anspruchsgrundlage. Bedient er sich hier der Hilfe eines Anwalts zum Beispiel für die Abfassung des Ablehnungsschreiben, bleibt er also auf den Kosten für seinen Anwalt sitzen. Anders sieht es aber aus, wenn sich die Forderungsgeltendmachung als vorsätzlich versuchter Betrug entpuppt.
Vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel standen unberechtigte Forderungen eines Anwalts im Zentrum der Auseinandersetzung. Dieser hatte Kostenrechnungen an zwei Personen adressiert, ohne dass mit diesen je ein entsprechendes Mandatsverhältnis bestanden hätte. Das Amtsgericht sprach den Betroffenen den Ersatz sämtlicher, auch vorgerichtlicher, Anwaltskosten für die Forderungsabwehr zu (AG Brandenburg, 26.2.2024, 30 C 221/23, ZAP 6/2024 v. 20.03.2024).
Februar 2024: Urteil des Monats
Ich werde von meinen Mandanten öfter einmal gefragt, ob man in einer Klageschrift unbedingt seine Anschrift mitteilen muss. Der Bundesgerichtshof hat meine bejahende Antwort aktuell nochmals bestätigt: eine ordnungsgemäße Klageerhebung setzt grundsätzlich die Angabe der ladungsfähigen Anschrift der oder des Klagenden voraus. Wird diese Angabe, obgleich möglich, ohne zureichenden Grund - wie etwa schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen - verweigert, ist die Klage grundsätzlich unzulässig. Dies gilt auch dann, wenn der Kläger in dem Gerichtsprozess durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten ist (BGH, 7.7.2023, V ZR 210/22, ZAP 03/2024 v. 7.2.2024).
Januar 2024: Urteil des Monats
Bekanntlich bedarf die Befristung eines Arbeitsverhältnisses der Schriftform (§ 14 IV TzBfG). Das Bundesarbeitsgericht (BAG) musste sich mit der Frage befassen, ob das Schriftformerfordernis verletzt wird, wenn (nur) der Arbeitsbeginn einvernehmlich vorverlegt wurde - ohne diese Vorverlegung schriftlich festzuhalten. Laut BAG muss zur Wahrung des Schriftformerfordernisses lediglich das Beendigungsdatum schriftlich fixiert sein. Das Schriftformerfordernis wäre jedoch dann tangiert, wenn sich der Endzeitpunkt des Vertrags durch den vorgeschobenen Anfangszeitpunkt verändern würde. Das war hier nicht der Fall (BAG, 16.8.2023, 7 AZR 300/22, ZAP 01/2024 v. 5.1.2024).
Suchen Sie eine ältere Meldung? Diese finden Sie im Archiv